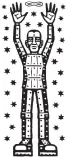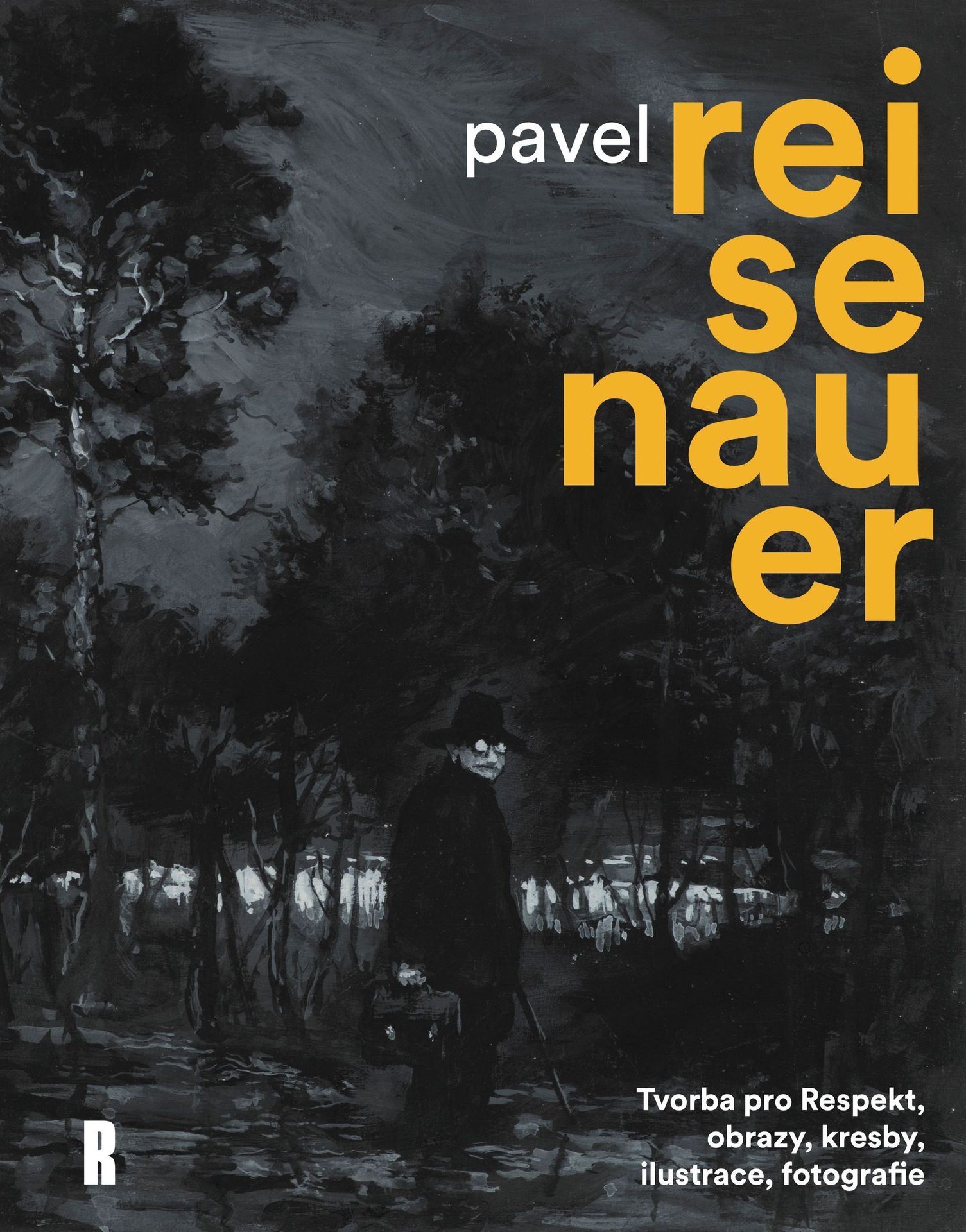Die Reise eines Millionärs in die Wildnis
Der amerikanische Unternehmer und Millionär Douglas Tompkins (60) steht kurz davor, sich seinen Traum zu erfüllen: in der Wildnis des chilenischen Patagonien entsteht der Naturpark Pumalin, das größte private Schutzgebiet der Welt.
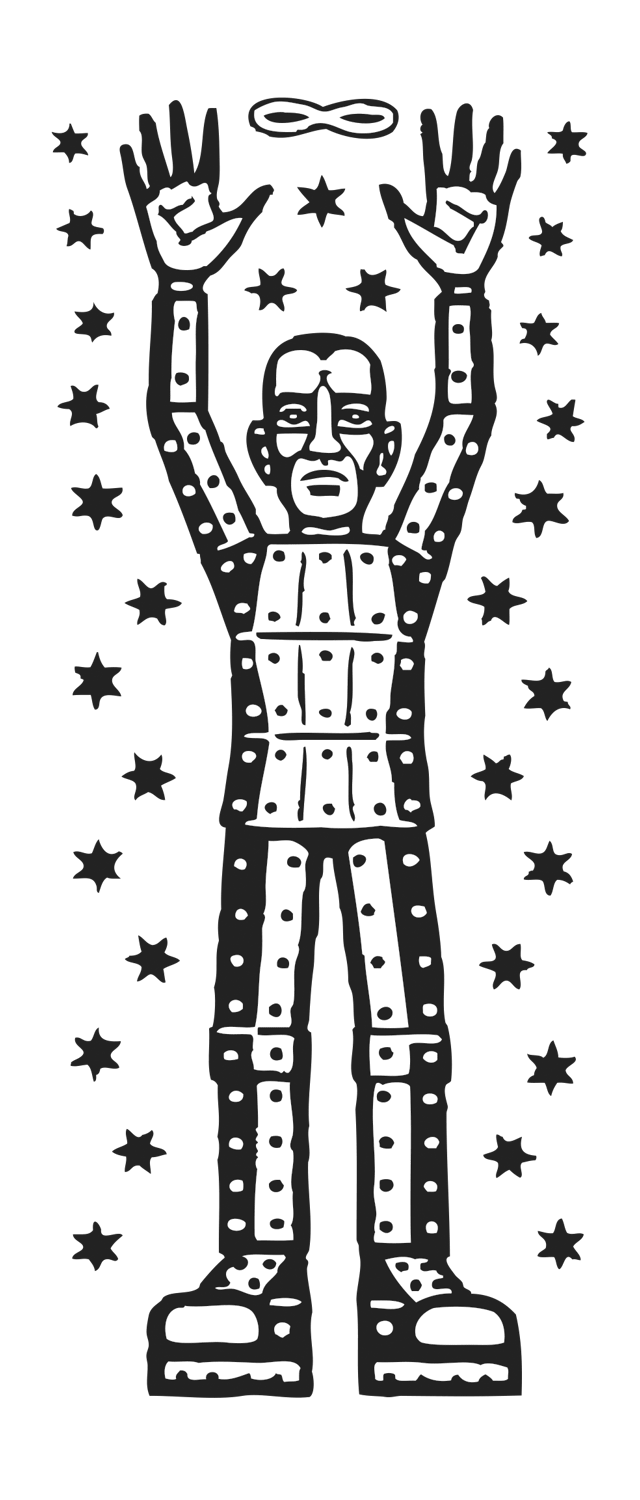
Der amerikanische Unternehmer und Millionär Douglas Tompkins (60) steht kurz davor, sich seinen Traum zu erfüllen: in der Wildnis des chilenischen Patagonien entsteht der Naturpark Pumalin, das größte private Schutzgebiet der Welt. Bei seiner Errichtung mußte Tompkins unerwartet starke Widerstände seitens der Armee, aber auch seitens der demokratisch fühlenden politischen Elite überwinden. Das Ergebnis eines Investments von Dutzenden von Millionen Dollar und zehn Jahren eines Menschenlebens sind die Bewahrung von dreihunderttausend Hektar unberührtem Regenwald und ein neues Phänomen: Naturschutz, der aus privater Tasche finanziert wird.
Grüne Wüste
Im weitentfernten Europa erreicht der Sommer gerade seinen Höhepunkt, aber hier im tiefen Regenwald der chilenischen Provinz Palena regnet es kalten Regen. Wir befinden uns mehr als tausend Kilometer südlich von der Hauptstadt Santiago und damit an der fließenden Grenze der modernen Zivilisation - die erst im Bau befindlichen Straßen sind noch nicht zu einem Verkehrsnetz verbunden. In diesem Teil des südamerikanischen Kontinents fallen die schroffen Abhänge der Anden direkt in die kühlen Wellen des Stillen Ozeans ab, um dort ein verwirrendes Labyrinth aus Kanälen und Fjorden zu schaffen. Auf den undurchdringlichen Dschungel, der hier noch die kleinsten Ausläufer des Festlands vereinnahmt, fällt in wellenartig auffrischenden Schauern praktisch ohne Unterlaß kühler Regen.
Das Unwirtliche und Abgelegene dieser Landschaft, das Darwin in seinen Tagebüchern als „grüne Wüste“ bezeichnet hat, hat bewirkt, daß erst zu Beginn des 20. Jh. erste Siedler ernsthaftes Interesse an ihr zeigten. Seit den Sechzigern haben sich den ursprünglichen Farmern und Fischern neue Besucher hinzugesellt - Bergsteiger, Wildwasserfans und Freunde der Wildnis als solcher. Zu den ersten dieser Abenteurer in Gummistiefeln gehörte auch der heutige Eigentümer von rund einem Drittel der Provinz, der Amerikaner Douglas Tompkins.
Tompkins Pilgerschaft ins chilenische Patagonien dauerte eine lange Wegstrecke. Der junge Mann aus einer Kleinstadt im Staat New York ging als Siebzehnjähriger vorzeitig von der High School ab und machte sich auf Wanderschaft um die Welt. „Die Wildnis hat mich gereizt, am wohlsten fühlte ich mich unter den Sternen, im Wald oder auf den Gletschern,“ erzählt der heutige Millionär. Tompkins verbrachte mehrere Monate im Jahr im Gebirge und in der freien Wildbahn und wurde ein anerkannter Bergsteiger und Wildwasserkajakfahrer. Ebenso intensiv erlebte er die Atmosphäre der 60er Jahre zuhause in den Vereinigten Staaten - er nahm an Antikriegsdemonstrationen teil und an Veranstaltungen von Bürgerrechtsbewegungen. Damals machte er auch erste Bekanntschaft mit der in ihren Anfängen begriffenen Naturschutzbewegung. Und begann, unternehmerisch tätig zu werden: er gründete die Sportbekleidungsfirma The North Face, die allerdings unter seiner Leitung bei weitem nicht ihren heutigen Bekanntheitsgrad erreichte. Tompkins verkaufte sie Ende der Sechziger für „lumpige“ 50.000 Dollar. Das Glück begegnete dem heutigen Ökophilantropen auf einer Reise per Anhalter, als ihn in Kalifornien seine künftige erste Frau Susie Russell mitnahm.


Wohin die Splitter fliegen
Das Tor zur Provinz Palena ist der Hafen Puerto Montt. Die Straßen der Industriestadt mit neunzigtausend Einwohnern krachen aus allen Nähten. Der Abend rückt näher. Die bewegungslos graue Oberfläche des Pazifiks umschließt die abbröckelnde Betonpromenade, über die Jugendliche auf ihren Skateboards jagen. Am Horizont verschwimmt das stählerne Band der Bucht mit den Umrissen der weit entfernten Berge, die da und dort hinter einer Schicht von Wolken verborgen sind. Vom Fenster unseres Zimmers in einem leerstehenden Hotel eröffnet sich der Blick auf großzügige Berge von Schnittholz im Hafen. „Chile ist ein traditionell auf den Rohstoffexport ausgerichtetes Land,“ erklärt Adriana Hoffmann (63) den Ursprung dieses künstlichen Gebirges. Frau Hoffmann ist eine elegante Dame, die der Problematik der chilenischen Flora zwölf Bücher und den Großteil ihres Lebens gewidmet hat. „Ungefähr die Hälfte des Exports des Landes besteht in eben diesem Rohholz, und sein Anteil am Exportvolumen steigt.“ Frau Hoffmann, Koordinatorin der Organisation Defensores del Bosque Chileno (Verteidiger der Wälder von Chile), ist eine Kultfigur unter den chilenischen Ökologen. Ihr Kampf für den Erhalt der Überreste des ursprünglichen Urwalds reicht von persönlicher Überzeugungsarbeit bei Grundbesitzern bis zu Lobbyismus im Parlament. „Hier im Süden ist unter den Kleingrundbesitzern kein großes Interesse an Grundstücken,“ sagt die Biologin. „Die einheimischen Farmer brennen den Urwald nieder, um Weidegrund für ihr Vieh zu gewinnen; sie stoßen aber nicht nur auf die Unbillen der Natur, sondern haben auch mit dem Rückgang der Preise zu kämpfen, deshalb ziehen sie sich mehr und mehr aus der Wildnis zurück.“ Eine unverhältnismäßig größere Gefahr als die, die in der Ausbreitung der Siedler besteht, ist der Ausverkauf großer Urwaldgebiete an globale Fördergesellschaften wie z.B. die kanadische Trillium. Die roden den scheinbar unerschöpflichen Urwald bis auf die kahlen Stümpfe; die gefällten jahrhundertealten Bäume enden, zu Splittern zermahlen, im Bauch japanischer Schiffe. Auf der anderen Seite des Ozeans wird Papier für Fotokopierer daraus gemacht.
Nach Schätzungen der chilenischen Nationalbank könnten die einheimischen Regenwälder auf diese Weise in weniger als zwanzig Jahren verschwunden sein. Der Staat investiert dabei nicht gerade Unsummen in den Naturschutz. „Die staatlichen Stellen haben sich zum Schutz von lediglich zehn Prozent der bedrohten Ökosysteme Chiles verpflichtet. Geld für mehr sei nicht vorhanden,“ sagt uns Frau Hoffmann. Die regendurchweichte üppige Wildnis, eines der reichhaltigsten Ökosysteme unseres Planeten, könnte also im Laufe einer einzigen menschlichen Generation zu einer wirklichen kalten Wüste werden - und sich in Stöße bedruckten Papiers verwandeln.
In Puerto Montt steht die moderne Zivilisation im Konflikt mit der Quelle ihres Reichtums, der ungebändigten Wildnis. Nicht weit vom Stadtzentrum residiert in einer Villa, die von einer hohen, verwitterten Mauer umgeben ist, Tompkins' Stiftung The Conservation Land Trust, die das Land des Amerikaners verwaltet - das bewunderte, aber auch verhaßte Pumalin. Wenn auch der Sitz der Stiftung von außen nicht gerade einladend wirkt: der hochgewachsene schlanke Mann in den Sechzigern in grauen Cordhosen und grauem Pulli, der uns auf den Stufen im Innern des Gebäudes willkommen heißt, macht diesen Eindruck mehr als wett.
Tompkins begann seine Laufbahn als erfolgreicher Unternehmer mit der Gründung des Bekleidungsunternehmens Esprit de Corps. Die Gesellschaft, die ursprünglich vom Wohnzimmer der Tompkins aus geleitet wurde, hat heute Filialen in sechzig Ländern der Erde und macht jährlich ungefähr eine Milliarde Dollar Umsatz. „Das war schon ein Abenteuer, ich war ja nie der typische Unternehmer,“ meint heute Tompkins, seinerzeit „Kreativdirektor“ der Firma. Esprit machte sich einen Namen durch Farbenvielfalt und Leichtigkeit und durch das unbestrittene unternehmerische Talent beider Partner, die die Konkurrenz hin und wieder ganz schön ins Schwitzen brachten - zum Beispiel, als sie in den Achtzigern mit einer erfolgreichen Antikonsumkampagne auftraten, unter dem Slogan ‚Kauft nur, was ihr wirklich braucht'. Die Angestellten der Firma erhielten als Sondervergütung anstatt Geld Skiwochenenden oder Raftingaufenthalte in Afrika. Der Firmengründer selbst verbrachte ein Drittel des Jahres auf Expeditionen in den Anden, im Himalaya oder in der Antarktis. „Heute kann ich selbst nicht mehr verstehen, warum ich mich so vom Unternehmen habe auffressen lassen,“ schüttelt der talentierte Geschäftsmann den Kopf und macht sich ein paar Scheiben Toast. „Ich hab mich in die isolierte Welt des Managements, der Geschäftemacherei und der Imagebildung vergraben und aufgehört, die Dinge um mich herum wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, daß ich statt dessen nicht zum Beispiel bei den radikalen Ökoaktivisten von Earth First! gelandet bin, wo ich natürlich hingehört hätte.“
Ungefähr ab der Mitte der Achtziger wurden die Ausflüge des Chefs in die Wildnis immer länger. Irgendwas war nicht in Ordnung, die Welt des Unternehmers war nicht so farbenfroh wie die Produkte, die er herstellte. „Der Umbruch kam plötzlich,“ sagt Tompkins - nach seinen Worten angesichts des Buchs von George Sessions und Bill Davall, ‚Deep Ecology: Living as if Nature Mattered' (Tiefenökologie: Leben als ob die Natur zählt). „Während der paar Stunden, die ich zum Lesen dieses Buches brauchte, hatte ich ein Erweckungserlebnis. Alles machte auf einmal Sinn,“ erinnert sich Tompkins an den entscheidenden Augenblick. Als Bergsteiger hatte er die Bedeutung der Wildnis intuitiv verstanden, das Buch aber gab seiner Intuition eine rationale Grundlage. „Die Autoren stellten die Natur an erste Stelle und sprachen von etwas, was sie Biozentrismus nannten. Mir ging auf, daß sich genau an diesem Punkt die Geister scheiden. Ich fühlte, daß ich auf dem Weg zu einer neuen Erkenntnis war.“ Tompkins entschloss sich, aus dem Business auszuscheiden. „Mir wurde klar, daß die Herstellung und Bewerbung von Produkten, die in Wirklichkeit für niemanden lebensnotwendig sind, eine der Ursachen für die gegenwärtige ökologische Krise darstellen. Ich selbst war Teil des Problems! Ich mußte einen Neuanfang machen und mich auf die Seite derer schlagen, die Lösungsansätze zu bieten hatten.“
1990 verkaufte Tompkins seinen Anteil an der Firma und ließ sich von seiner ersten Frau scheiden. Die Welt des Unternehmertums verließ er, je nachdem welcher Quelle man Glauben schenken will, mit 150 bis 250 Millionen Dollar in der Tasche.
Was will dieser Gringo?
„Die Ankunft von Doug Tompkins war ein Segen für Palena,“ bewertet der Bischof Juan Luis Ysern de Arce (73) die Ereignisse in seiner Diözese. Monsignore Ysern ist bereits seit fast dreißig Jahren das Oberhaupt der hiesigen katholischen Kirche. Das Gebiet, dem er als geistlicher Hirte vorsteht, ist dünn von Farmern und Fischern besiedelt, deren übliches Monatseinkommen noch nicht einmal die Hälfte des Durchschnittslohns in Chile erreicht. „Das Hauptproblem Palenas liegt darin begründet, daß es hier keinerlei Traditionen gibt, nichts, worauf ein Gemeinwesen aufbauen könnte. Entwurzelte Menschen halten sich nicht mit Gedanken darüber auf, ob es richtig ist, einen viertausend Jahre alten Baum zu fällen. Sie sehnen sich nach Fortschritt, Zivilisation, wollen ihre Bedürfnisse befriedigen, und zwar sofort,“ sagt der Bischof.
Eine klare Vorstellung davon, was die Entwicklung der Region anbelangt, hatten die amtlichen Stellen in der entfernten Metropole: unter der Pinochet-Diktatur wurde hier mit schweren Maschinen die unbefestigte Südroute durch den Wald gepflügt - der Camino Austral, der das Gebiet der modernen Welt öffnen sollte. Der Ausbau erforderte annähernd 300 Millionen USD und sollte Millionen neuer Siedler in die Region locken. Die sind allerdings nie im unwirtlichen Palena angekommen.
Dafür tauchte aber 1991 der ehemalige Esprit-Eigentümer auf. Seine ursprüngliche Absicht war es, die vor dem Bankrott stehende Ranch Reńihue zu erwerben, die in einem abgelegenen Fjord ungefähr 120 km vom nächsten nennenswerten Ausläufer der Zivilisation entfernt liegt. Die Farm mit einer Ausdehnung von 17.000 Hektar ist nur per Flugzeug oder per Schiff erreichbar - und ihr frischgebackener Eigentümer erfuhr nach einiger Zeit, es gebe noch ausgedehnte Grundstücke in der Nachbarschaft zu erwerben. „Nach meinem Weggang von Esprit habe ich die Entstehung einer Plattform zur Förderung tiefenökologischen Gedankenguts finanziert, die Foundation for Deep Ecology. Dann wurde mir klar, daß ich ganz real in den Gang der Dinge eingreifen kann - indem ich konkretes Land kaufe und schütze,“ erzählt Tompkins. Von 1992 bis 1994 kaufte er dann zusammen mit seiner zweiten Frau Kris ca. 300 000 Hektar Grund und Boden auf, auf einem Gebiet, das sich von den Wellen des Stillen Ozeans bis zu den Höhenzügen der Anden an der Grenze zu Argentinien hinzieht. Sein Ziel war die Schaffung eines zusammenhängenden Schutzgebiets mit dem offiziellen Status eines Reservats.
„Wenn ich die Sache erst mal durchgezogen habe, soll Pumalin an den Staat zurückgegeben werden. Ich glaube nicht an private Schutzgebiete,“ erklärt Tompkins seine ungewöhnliche Absicht. „Private Parks können eine gute Übergangslösung darstellen, aber ich bin überzeugt, daß geschützte Gebiete, vor allem wenn sie so viel Raum einnehmen, der Öffentlichkeit gehören sollten. Der Auftritt von Privatkapital für einen Übergangszeitraum ist eine Option, wenn der Staat kein Geld für den Naturschutz hat. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für uns Reiche. Unser Vermögen haben wir dank der Tatsache erwirtschaftet, daß das System funktioniert, und wir sollten uns dafür auch in einer gewissen Weise revanchieren.“
Tompkins sollte allerdings erst noch lernen müssen, wie sich das Eigentum an Grundstücken von einer solchen Größe in ein explosives Problem verwandeln kann. Anfangs herrschte nämlich Ruhe. Die chilenische Gesellschaft begegnet privatwirtschaftlichen Aktivitäten ohne Vorurteile; der Verkauf auch großer Gebiete an ausländische Eigentümer ist übliche Praxis in diesem Land. Die Probleme begannen, als sich herausstellte, daß der reiche Gringo nach unkonventionellen Regeln spielt.
Nachdem die örtlichen, einst reichen Fischgründe Palenas erschöpft waren, wurden Lachsfarmen zum hauptsächlichen Broterwerb der Fischer von Palena. Die Fischkäfige mit den eingesperrten Lachsen säumen das wilde Ufer des Ozeans und bieten hunderte von Arbeitsplätzen. Nach Stimmen von Fachleuten freilich wird damit zugleich der letzte Nagel in den Sarg des maritimen Ökosystems getrieben. Die Lachszucht ist ein Business und die Fjorde Palenas sind eine Fabrik. Der Abfall, also die Überreste von Futtermitteln und Zuchttieren, wird üblicherweise ohne Zaudern auf dem unberührten Ufer entsorgt, auf dem außerdem Bäume gefällt und Seelöwen hingemetzelt werden. Wohl niemandem im Gemeinwesen von Fierdo Blanco wäre im Traum eingefallen, daß der neue Grundstückseigentümer etwas gegen Berge von vermodernden Abfällen oder die Ausrottung von Robben einzuwenden haben könnte. Der Rechtsstreit wegen unbefugten Betretens von Privatgelände wurde 1993 vor einem hiesigen Gericht abgeschlossen; Tompkins hatte ihn problemlos gewonnen.
Die Eigentümer der Lachsfarmen faßten die Sache allerdings als grundsätzliche Bedrohung ihrer Interessen auf. Tompkins' Vorhaben, für die Grundstücke von Pumalin das amtliche Siegel eines Schutzgebiets zu erwerben, drohte darüber hinaus die großen Forstgesellschaften aus dem Spiel zu werfen und die Errichtung eines Stromversorgungsnetzes von geplanten Wasserkraftwerken zu verkomplizieren. Zu den rein wirtschaftlichen Argumenten kam außerdem auf allerhöchster Ebene ein Element des Nationalismus hinzu. „Chile hat weder den Bedarf noch den Wunsch, sich von jemandem sagen zu lassen, wie es mit seinem Territorium umzugehen hat,“ verkündete nach dem Prozeß die damalige Ministerin für staatliche Vermögenswerte Adriana Delpian. Tompkins' ungewöhnliches Projekt geriet ins Zentrum des Interesses sowohl der Boulevardblätter als auch der seriösen Medien, aber Unterstützung fand es weder in den einen noch den anderen. „Tompkins steht hinter den Problemen des chilenischen Handels,“ titelte das rechtskonservative Blatt La Tercera. Pumalin, das von der Ausdehnung her zirka dem Dreifachen des Nationalparks Böhmerwald entspricht, war auf einmal für viele ein zu großer Brocken: „Als Chilene kann ich nicht zulassen, daß ein Ausländer ein Stück meines Landes von den Bergen bis zum Ozean besitzt, vor allem wenn nicht klar ist, was er mit dem Land wirklich vorhat, und wenn es um ein strategisch wichtiges Gebiet geht,“ verkündete der christdemokratische Senator Gabriel Valdes vor Pressemikrofonen.
Auch die Armee, deren Einfluß auch nach dem Sturz von Pinochets Diktatur weit reicht, hat begonnen, wegen Tompkins nervös zu werden. Pumalin durchschneidet das Staatsgebiet von Chile und teilt es in zwei Teile. Das Gebiet des Parks liegt darüber hinaus an den Ufern des Fjords Comau, der eine wichtige Rolle in den strategischen Plänen spielt, die die Armee für den Fall eines hypothetischen bewaffneten Konflikts mit Argentinien aufgestellt hat. Tompkins und sein Park sind damit auf dem Verzeichnis staatlicher Sicherheitsrisiken gelandet.
Die Ungunst der Regierung, unternehmerischer Kreise, der Armee sowie der Medien hat Pumalin schließlich auch in der Praxis einen Rückschlag versetzt. In dem Puzzle kleinerer und größerer, von Privateignern erworbener Grundstücke fehlte Tompkins ein Mosaikstein - 30.000 Hektar im Besitz der Universität von Valparaís. Die Regierung witterte ihre Chance und setzte sich für den Verkauf des Grundstücks an den Energiekonzern Endesa ein, obwohl Tompkins einen um das Mehrfache höheren Kaufpreis geboten hatte. Pumalin passierte damit genau das, was es selbst mit dem Staatsgebiet Chiles bewirkt hatte: es wurde geteilt.
„Ich Naivling dachte, die würden mir dankbar sein,“ erinnert sich Tompkins daran, wie damals die Gefühle hohe Wellen schlugen. Rechnet man der beschriebenen politisch-medialen Kampagne noch hinzu, daß seine Telefone abgehört, seine Ranch zur Einschüchterung von Jagdflugzeugen der Armee überflogen, und seitens der Neonaziorganisation ‚Era hitleriana' Todesdrohungen ausgesprochen wurden, so sind Tompkins' Ernüchterung und Überdruß verständlich. Die Regierung von Präsident Frei unterzeichnete zwar im Jahre 1997 eine formale Vereinbarung mit Tompkins, worin sie sich verpflichtete, Pumalin den neu geschaffenen Status eines Naturreservats zu verleihen, im Gegenzug für den Ausbau der Infrastruktur des Parks. Den Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen bemühte sich allerdings nur der Ökophilantrop, der dann im Jahre 2001 das Maß gestrichen voll hatte. „Ich ziehe mich aus dem Projekt Pumalin zurück. Gewisse einflußreiche Kreise sind dagegen, daß dieses Schutzgebiet entsteht,“ teilte Tompkins auf einem Treffen mit der politischen Führung des Landes mit.
Die Rettung für das Projekt kam in letzter Minute. Tompkins' Absicht, Chile zu verlassen, rief in den Kreisen chilenischer Naturschützer Entsetzen hervor; den angewiderten Millionär stimmte u.a. auch die bereits erwähnte Adriana Hoffmann um. „Ohne Leute wie ihn haben die chilenischen Urwälder keine Chance; Tompkins setzt außerdem ein Beispiel für die Hiesigen,“ erklärt die Biologin ihr Engagement. In der Angelegenheit macht sich auch der neue chilenische Präsident Richardo Lagos stark. „Ich denke von Herrn Tompkins nur das Beste; seine Tätigkeit ist für uns von größter Bedeutung,“ erklärte er und bat den amerikanischen Unternehmer um Geduld.
Es geht hier nicht um die Menschen
Im wichtigsten Zentrum von Pumalin - Caletje Gonzales - halten Geländewagen und ein Lastwagen auf der Kiesstraße. Aus den Fahrzeugen steigen Arbeiter in gelben Gummimänteln in den Dauerregen und nehmen Schaufeln in die Hand. Douglas Tompkins tritt in Schaftstiefeln und mit einer legeren Schildmütze in ihre Mitte. Angestellte des Parks sind gekommen, um Schadensbeseitigung zu betreiben - wilde Deponien abzuräumen und die Abschnitte aufzuforsten, die durch die Umtriebe indogener Farmer und durch den Straßenbau zerstört wurden. „Sinn und Zweck dieses Parks ist der Naturschutz. Der Park ist groß genug, um das gesamte lokale Ökosystem zu schützen. Die Menschen kommen hier erst an zweiter Stelle,“ sagt Parkaufseher Fernando Grandón (43). Jetzt im Juli, also mitten im Winter, sind hier ja auch gar keine Leute, außer ca. zweihundert Beschäftigten, die über das gesamte Schutzgebiet verteilt sind.
Der Park Pumalin ist vor allem Urwald. Dieser bewächst die Steilhänge des Hochgebirges und die Flußtäler und ist mit Ausnahme der erwähnten Straße aus Pinochets Zeiten, an deren Nordende wir gerade stehen, praktisch unzugänglich. Allerdings entsteht hier für die Besucher, deren Zahl jährlich zunimmt, ein Geflecht von Pfaden, Lagern mit Unterkünften und Informationszentren. „Camps, Infozelte, oder auch die Hinweistafeln auf den Wanderpfaden - das entwirft alles Douglas,“ verrät uns der Aufseher. Die kleinen Camps, die in der Sommersaison eine Woche im voraus ausgebucht sind, sind so gebaut, daß die Besucher sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. „Wir wollen, daß die Touristen morgens mit dem Blick auf einen See oder einen Vulkan aufwachen anstatt mit dem Blick aufs Nachbarzelt. Sie sollen von hier das Erlebnis mit nach Hause nehmen, das einem eine Begegnung mit der wahren Wildnis verschafft, und dieses Erlebnis soll in ihnen fortleben.“ Die Saison ist kurz; im Vorjahr waren während der zwei Sommermonate fast achttausend Besucher hier. (Der Park ist ganzjährig gratis geöffnet, gezahlt werden muß nur für die Unterbringung - das Camp kostet 5 Dollar pro Nacht.) „Wir sind natürlich froh, daß die Leute kommen, aber am wichtigsten ist für uns die Natur: niemand darf die abgesteckten Pfade verlassen, darauf achten unsere Mitarbeiter,“ sagt der Aufseher Fernando.
Ein Projekt, das über das Tagesgeschäft von Naturschutzgebieten hinaus geht, ist der Modellbetrieb der Biofarmen, die auf dem Parkgelände errichtet worden sind. Die dahinterstehende Idee ist simpel: so zu wirtschaften, daß die Höfe selbsttragend funktionieren, ohne daß die üblichen aggressiven Methoden zum Einsatz kommen müssen - Kunstdünger, Kahlschlag, Brandrodung für die Viehzucht. Freilich bedarf es erheblicher Investitionen, um die Farmen in Gang zu bringen und zu betreiben - und ohne gewaltige Zuschüsse aus Tompkins' eigener Tasche könnte auch heute noch keine von ihnen existieren.
Die meisten Farmen hat Tompkins entlang der Grenzen seines Parks errichtet, wodurch deren Bewohner - einige davon gehören zu den ursprünglichen örtlichen Bauern, deren Interessen ansonsten der Zielsetzung des Parks diametral entgegenstehen dürften - zugleich als Wächter des neu entstandenen Naturschutzgebiets fungieren. Auf den Farmen werden unter anderem auch Bienen ohne Zufütterung gezüchtet. Obwohl die Bienenzucht in Patagonien keine Tradition hat, stellen die Erlöse aus dem Honigverkauf die hauptsächliche kommerzielle Einnahmequelle des Parks dar. „Ich bin hier jetzt anderthalb Jahre,“ erzählt die argentinische Imkerin Teresa McDonnell (31) in einem wohnlichen Häuschen tief im Reńihue-Fjord. „In Argentinien hab ich alles verloren, da habe ich keine Minute gezögert, als ich das Inserat in einer Zeitschrift sah,“ sagt sie.
Auch die Schafzucht ist nicht ohne Belang. Die ist auf dem erosionsanfälligen durchnäßten Boden vorteilhafter als die althergebrachte Rinderzucht, und die Wollverarbeitung ist für die Weberinnen, die jenseits der Parkgrenzen leben, eine wichtige Einnahmequelle.
Vor einem armseligen Holzhäuschen im Dorf Piedra Azul, einige Kilometer von Puerto Montt, hält ein weißer Lieferwagen. Der erste Raum wird von einem abgegriffenen Verkaufspult mit Marmelade, Butter und Keksen eingenommen, weiter hinten verbirgt sich eine Webstube mit dem typischen Handwebstuhl der Mapuche-Indianer. Die robust gebaute Weberin Yolanda García (50) webt auf ihm mit ihrem Lehrling Marta (18) traditionelle Decken und bringt acht weiteren Weberinnen das Handwerk bei. „Dank Frau Tompkins haben wir Arbeit. Unsere Männer verdienen mit dem Fischfang nicht viel, also sind eigentlich wir Frauen die Ernährer der Familie,“ erzählt Yolanda stolz. Die Koordinatorin des Projekts Webereiprodukte, die schlicht auftretende braunhaarige Carmen Joost, lädt fertige Decken auf, die mit Kastanienblättern gefärbt wurden, und mit grüner, aus Distelblättern gewonnener Farbe. Sorgfältig bemißt sie den Wollbedarf für weitere Produkte und bricht dann ins Nachbardorf auf, wo die Gruppe der zierlichen Ilse González (48) auf sie wartet. „Ich stricke so an die sechs Pullover pro Monat. Die Tompkins schätzen traditionelles Weber- und Strickhandwerk. Vor allem aber wissen sie, wie sie unsere Erzeugnisse in den Vereinigten Staaten verkaufen können. Unsere eigenen Kinder würden diese handgestrickten Pullis niemals anziehen; was wir hier tun, kommt ihnen unmodern vor.“
Kris, die Ehefrau von Tompkins, hat dieses Projekt vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Die Farmen in Reńihue produzierten genug Wolle, um den hiesigen Leuten Arbeit und Brot zu verschaffen. Die Produkte unter der Marke Puma Verde finden guten Absatz; die Weberinnen sind momentan mit Aufträgen förmlich eingedeckt. „Der Kontakt mit diesen Frauen ist für mich eine Bereicherung, ich freue mich immer, sie zu besuchen und verbringe viel Zeit mit ihnen. Wir unterhalten uns über neue Muster, die Qualität der Wolle, die Kinder, Krankheitsfälle… Ich bin froh, daß es ihnen dank diesem Projekt besser geht,“ lächelt Carmen zufrieden und scheucht geduldig den lehmverklebten Köter von sich, der uns im nächsten Dorf Reloncave zur Begrüßung entgegenkommt. „Ich habe für Seňora Kris einen neuen Grünton. Und bringen Sie ihr diesen Schal, ich bin neugierig, was sie dazu sagen wird!“ ruft die Weberin Manolita in die Stille des grauen Horizonts.
Aus Sicht der Ewigkeit
Nach mehr als zehn Jahren von Tompkins' Präsenz in Palena scheint es, als ob die Geschichte ein glückliches Ende nimmt. Im Oktober dieses Jahres soll Präsident Lagos den Park offiziell als privates Naturreservat ausrufen. Die Unterschrift auf dem präsidialen Dekret kann aber natürlich nicht von einem Tag auf den anderen die traditionelle Wahrnehmung des Volks ändern. Die chilenische Gesellschaft wird hier zum ersten Mal mit einer privaten Naturschutzinitiative dieses Ausmaßes konfrontiert. „Ich verstehe es ja, wenn sich jemand Forstland kauft, dann einen Zaun darum herum baut und Eintrittsgeld verlangt, damit sich die Investition rentiert. Aber Tompkins tut nichts dergleichen,“ schüttelt der Bürgermeister von Puerto Montt, Rabindranath Quinteros (59), düster den Kopf. Mögliche Ursachen für die fortdauernden Mißverständnisse kommentiert auch der Rektor der Universität von Santiago de Chile, Antonio Elizarde: „Unsere Gesellschaft hat keine Erfahrung mit Leuten, die transparent vorgehen und tatsächlich tun, was sie sagen. Tompkins ist darüber hinaus das Paradebeispiel eines philantropischen Unternehmers. Er fühlt sich gegenüber der Gesellschaft und der Natur verantwortlich, was in Chile etwas nie Dagewesenes ist.“
Tompkins' Beispiel findet dennoch ein erstes Echo in der chilenischen Öffentlichkeit. Die Mehrzahl der zehntausend Besucher im Vorjahr waren Chilenen; viele von ihnen sind aus Neugier in diese entfernte Ecke ihres Landes gekommen. „Tompkins' Name war in der Presse vielleicht noch häufiger als der Pinochets und die Leute wollen seinen Park sehen. Die meisten sagen, sie wollen wiederkommen,“ beschreibt Don Carlos, der Eigentümer eines Hotels im Städtchen Chaitén an der Grenze zum Park, seine Klientel. Auch wenn die chilenischen Urwälder weiterhin bedroht sind, so ist doch ihr Wert in den Augen wenigstens eines Teils der Bevölkerung gestiegen. „In Chile gibt es ein ganzes Netz kleiner privater Schutzgebiete, aber erst jetzt kommt eine neue Mode unter den erfolgreichen Unternehmern der Region auf,“ erklärt Adriana Hoffmann mit verschmitztem Lächeln. „Tompkins' Beispiel hat andere auf Ideen gebracht - nein, ich möchte niemanden beim Namen nennen, aber eine Gruppe einflußreicher Leute holt sich bei Tompkins Ratschläge, wie man das Ganze aufzieht.“
In seinem kleinen Arbeitszimmer im Städtchen Ancud sitzt Bischof Ysern. „Wissen Sie, eigentlich hat Tompkins mein Herz definitiv gewonnen, als ich erfahren habe, daß er in seinem Park eine Baumschule für kleine Thuja-Koniferen angelegt hat. Die Thuja (hier Alerse genannt) ist ein Baum, der dreieinhalbtausend Jahre alt werden kann, und wir Chilenen betrachten ihn als Nationalsymbol. Nur daß die meisten von uns noch nie einen in Wirklichkeit gesehen haben,“ lacht der Bischof. „Niemand zieht Thuja-Koniferen in Baumschulen heran, einfach deshalb, weil es sich nicht rentiert. Doug pflanzt diese Bäume bei sich und ich fahre hin, um sie zu weihen. Wir zwei sehen die Welt aus dem gleichen Blickwinkel - aus Sicht der Ewigkeit.“
So leben, als ob die Natur zählt Die Grundsätze der Tiefenökologie formulierte als erster der norwegische Philosoph Arne Naess. Grundstein ist dabei die Abkehr vom Anthropozentrismus, in dem sich der Wert der Natur allein an ihrer Nützlichkeit für den Menschen bemißt, und die Hinwendung zum Biozentrismus, der allem Belebten seinen eigenen immanenten Wert zuschreibt. Die Grundthesen der Tiefenökologie werden üblicherweise in acht grundlegenden Punkten formuliert:
Das Gedeihen menschlichen Lebens und allen anderen irdischen Lebens ist von eigenem Wert. Der Wert von Lebensformen ist nicht abhängig von deren Nützlichkeit aus der Sicht enger menschlicher Interessen.
Der Überfluß und die Vielfältigkeit des Lebens sind Werte an sich und bereichern das Leben der Menschen ebenso wie alles andere irdische Leben.
Der Mensch hat kein Recht, diesen Überfluß und diese Vielfalt einzuschränken - die einzige Ausnahme ist die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse.
Die gegenwärtigen Übergriffe des Menschen in die Natur sind unerträglich und die Situation verschlechtert sich zunehmend.
Leben und Kultur der Menschheit leiden in keiner Weise, wenn die Zahl der Erdbevölkerung deutlich reduziert wird. Eine gesunde Natur ist ohne einen solchen Bevölkerungsrückgang nicht möglich.
Eine wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen ist ohne politische Änderungen nicht möglich, weil diese Einfluß nehmen auf die wirtschaftlichen, technischen und ideologischen Strukturen.
Der ideologische Paradigmenwechsel beruht vor allem in der Wertschätzung von echter Lebensqualität (die sich aus sinnstiftenden Situationen herleitet) im Gegensatz zu bloßem Lebensstandard.
Wer sich mit den vorgenannten Punkten identifiziert, ist verpflichtet, unmittelbar oder mittelbar an dem Versuch mitzubauen, die notwendigen Änderungen durchzusetzen.
Interview
Gespräch Wenn man auf dem Gletscher Rohstoffe fördern könnte, würden sie auch das tun, meint der Schriftsteller, Musikologe und Ästhetiker Luis Gastón Soublette (76)Wozu braucht der Mensch die Natur?
Diese merkwürdige Frage verdient eine noch merkwürdigere Antwort. Der Mensch ist Natur, nur daß er in der Renaissancezeit aufgehört hat, sich dessen bewußt zu sein, zu einer Zeit, als der anthropozentrische Zugang zu allen Dingen, also auch zur Natur, begann, sich durchzusetzen. Auf einmal war die Natur für den Menschen da und nicht mit dem Menschen. Wie wirkt sich auf die Chilenen das Bewußtsein aus, daß sie in ihrem Land über ein so riesiges Gebiet „völliger Wildnis“ verfügen?
Überhaupt nicht. In Chile gibt es nur ganz wenige, die das überhaupt wahrzunehmen in der Lage sind. Der Mehrheitsbevölkerung ist es scheißegal, daß zum Beispiel gerade dieser Tage das Ökosystem unseres ursprünglichsten Flusses Bío Bío zerstört wird. Falls die Chilenen feststellen würden, daß man auf dem Gletscher oder im Nationalpark Torres de Paine Rohstoffe abbauen kann, würden sie das sofort tun. Wichtig ist für sie allein der Fortschritt. Womit natürlich der materielle Fortschritt gemeint ist. Wo ist der Hauptfehler passiert?
Ästhetik und Kultur sind im Niedergang begriffen, je mehr die industrielle Gesellschaft vordringt. Also seit dem 19. Jahrhundert. Jede große Kultur hatte ihre Techné, aber das Selbstverständnis unserer industriellen Kultur rechnet überhaupt nicht mehr mit der Natur als Partner. Wenige nur machen sich aber klar, daß Energie, Rohstoffe, Holz, natürliche Resourcen nicht unerschöpflich sind. Man kann das Universum nicht bis in alle Ewigkeit herausfordern. Als schädlich erweist sich auch das protestantische Denken, also die Weltanschauung der angelsächsischen Kultur, die heute die Welt beherrscht. Die hält es für ein Zeichen göttlicher Gnade, wenn es einem während des diesseitigen Lebens gelingt, Reichtümer anzuhäufen. Der Preis, den wir alle für dieses Denken zahlen, ist enorm. Wie kann man aus diesem Teufelskreis heraus?
Heraus? Das Chaos kommt, es ist schon eingetreten. Die einzige Hoffnung ruht auf unkonventionellen Leuten mit Vernunft, die sich eingestehen, wie die Lage wirklich aussieht.
L. G. Soublette ist Professor an der Pontificia Universidad Católica de Chile.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].