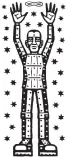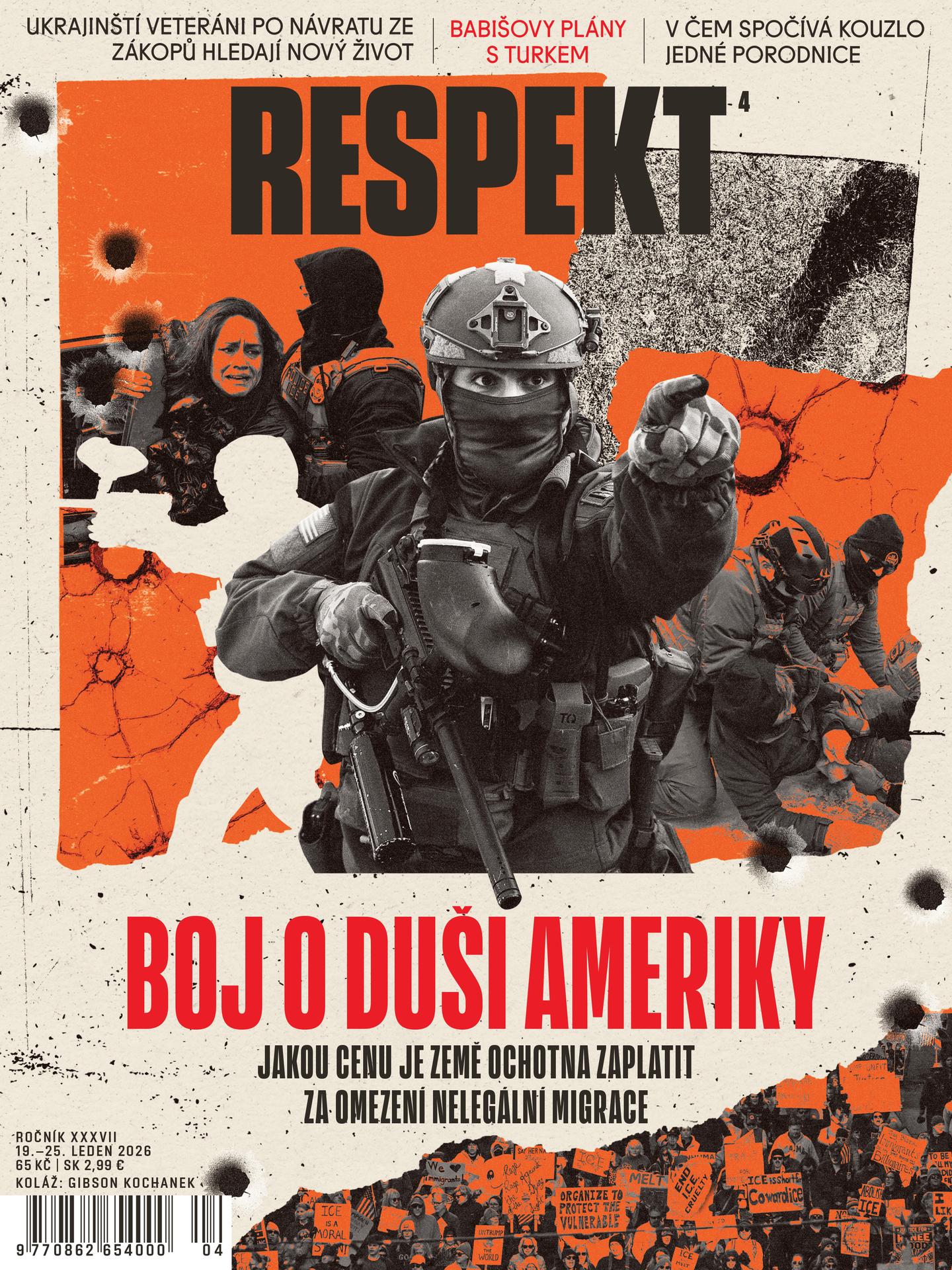Raus aus dem Käfig
Marco muss hier weg. Ganz schnell. Diese fremden Stimmen auf einmal, die neugierigen Blicke aus unbekannten Gesichtern – wenn es etwas gibt, das Marco nicht leiden kann, dann sind das unerwartete Überraschungen, wie etwa der Besuch fremder Journalisten.
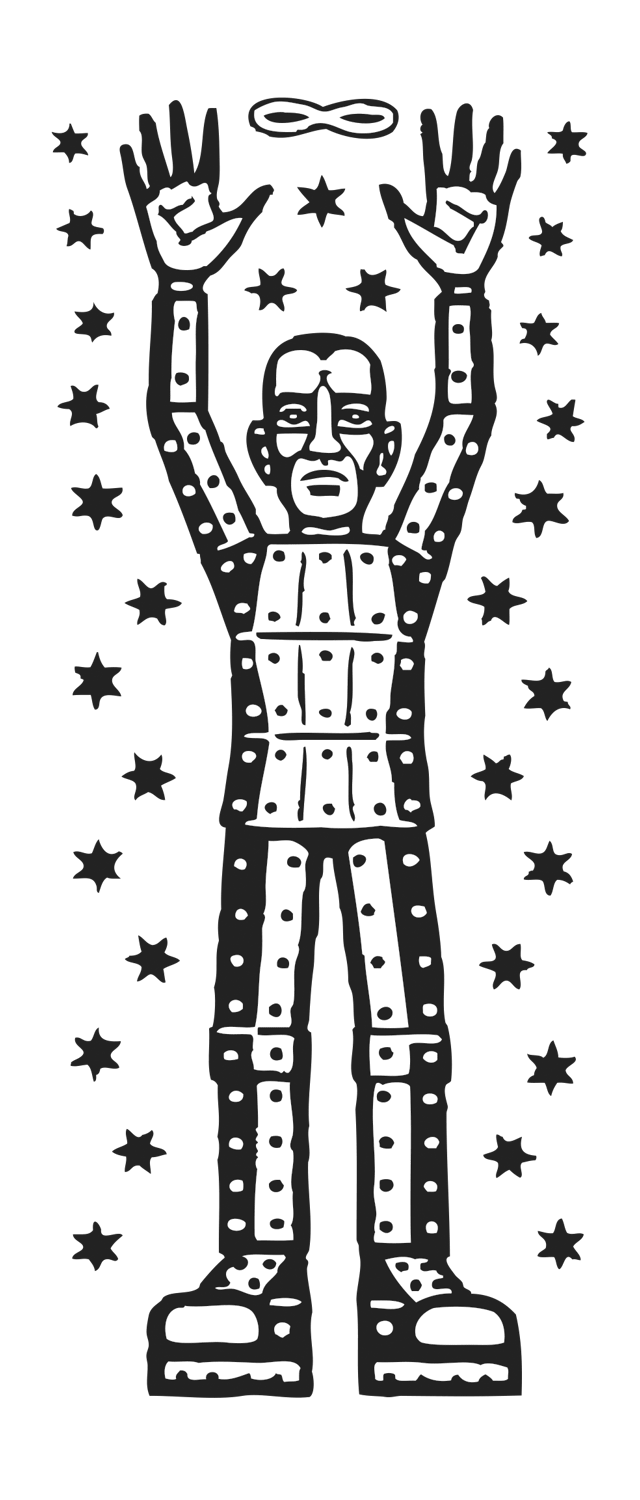
Und das ist auch kein Wunder. Die umstrittenen Betten sind nämlich nur das sichtbarste, aber bei weitem nicht das wichtigste Problem im tschechischen Umgang mit geistig behinderten Menschen. Worum es eigentlich geht, ist eine grundsätzliche Systemveränderung. Aber wie sehen moderne Behindertenwohnheime eigentlich aus? Wie steht es um die Qualität der tschechischen Heime? Und was muss passieren, damit Behinderte auch in diesem Land in Würde und Selbstbestimmung leben können?


Marco muss hier weg. Ganz schnell. Diese fremden Stimmen auf einmal, die neugierigen Blicke aus unbekannten Gesichtern – wenn es etwas gibt, das Marco nicht leiden kann, dann sind das unerwartete Überraschungen, wie etwa der Besuch fremder Journalisten. In solchen unbekannten Situationen weiss Marco oft gar nicht mehr, wohin mit all den vielen Bildern, Geräuschen, Gerüchen. Und dann verliert er leicht die Nerven. Manchmal tut es dann gut, laut zu schreien. Manchmal muss es mehr sein: Dann kommt es vor, dass Marco Gegenstände zerstört, andere Menschen angreift – oder sich selbst verletzt. Heute reicht die Flucht. Wie ein Pfeil schiesst Marco aus dem niedrigen Bett, in dem er eben noch wie jeden Tag nach dem Mittagessen ein bisschen geschlafen hat, stürzt hinaus auf den Gang, läuft hin und her, wedelt wild mit den Händen und stösst dabei helle, unverständliche Laute aus. Bis jemand ihm seine Schuhe bringt und Marco hinauslässt, in den umzäunten Garten. Draussen wirft er kleine Holzstöckchen durch die Luft.
Mehr als ein besseres Gefängnis
Mit Marco zusammenzuleben, ist nicht ganz leicht. Denn Marco ist Autist. Von Geburt an leidet der 33jährige mit den grossen blauen Augen und dem dunkelblonden Haar unter einer schweren Entwicklungsstörung, die es ihm unmöglich macht, die Welt so wahrzunehmen wie gesunde Menschen und durch Sprache mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Agressionsausbrüche gegen sich und andere, unkontrollierte, bizarre Bewegungen und die zwanghafte Wiederholung der immer selben Themen, Worte oder Bewegungen fordern denen, die mit Autisten zu tun haben, ein Maximum an Gleichmut und Nervenstärke ab. Einfacher ist es deshalb, Menschen wie Marco einfach daran zu hindern, die Symptome ihrer Krankheit überhaupt auszuleben. Und wenn Marco nicht im Nordwesten Deutschlands, sondern ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich, in Tschechien leben würde, dann liefe er jetzt vielleicht tatsächlich nicht in einem Garten herum, sondern läge in einem Bett hinter Gitterstäben. Obwohl das Gesetz über soziale Dienste es verbietet, die Bewegungsfreiheit der Bewohner sozialer Einrichtungen ohne akuten und schwertwiegenden Grund einzuschränken, haben ein Fernsehteam der britischen BBC und das Internet-Nachrichtenportal aktuálně.cz in den letzten Wochen einmal mehr nachgewiesen, dass es in Tschechien noch immer Einrichtungen gibt, in denen geistig Behinderte über längere Zeit und ohne erkennbaren Grund in Betten mit für sie unüberwindlichen Gitterwänden eingesperrt werden – mit der Begründung, sie davor zu schützen, aus dem Bett zu fallen, andere Menschen anzugreifen oder sich selbst zu verletzen. Wie immer in den letzten Jahren haben auch diese jüngsten Berichte wieder eine heftige Debatte über Sinn und Unsinnn der Gitterbetten ausgelöst. Dabei sind diese Betten lediglich der sichtbarste (und medial am besten zu vermittelnde) Aspekt eines sehr viel grundsätzlicheren Problems. Worum es in Tschechien eigentlich geht ist die Frage, wie den geistig und körperlich behinderten Menschen im Lande ein Leben in grösstmöglicher Selbstbestimmung, Würde und Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden kann. Organisationen wie etwa die Gesellschaft „Quip“ fordern daher, sämtliche Wohnheime für Behinderte abzuschaffen und sie durch eine Vielzahl von individuellen Pflegeangeboten im natürlichen Umfeld der Behinderten zu ersetzen. Das Ministerium für Arbeit und Soziales geht jedoch davon aus, dass Wohnheime zumindest für schwer geistig behinderte Menschen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Und tatsächlich müssen Behindertenwohnheime keine besseren Gefängnisse sein. Nicht nur das Beispiel des benachbarten Deutschland zeigt, dass Wohnheime ihren Bewohnern ein durchaus selbstbestimmtes Leben ermöglichen können. Auch in Tschechien gibt es inzwischen Heime, die denen in westlichen Staaten in nichts nachstehen. Die Frage ist, was passieren muss, damit bald schon kein behinderter Tscheche mehr Eingriffe in seine Rechte und seine Würde erdulden muss. Überraschenderweise hat die Antwort auf diese Frage weniger mit Geld zu tun, als vielmehr mit der Entscheidung, Behinderte nicht länger nur als Objekt der Sozialfürorge zu betrachten, sondern als Menschen mit eigenen Wünschen, Rechten und Bedürfnissen. Und treffen müssen diese Entscheidung nicht nur Politiker und Heime – sondern auch diejenigen, denen Bilder wie die der BBC eigentlich am meisten Schmerzen bereiten müssten: Die Eltern behinderter Menschen.
Anzug, Zigarette, Pistole
Das von der evangelischen Diakonie getragene Christophorushaus in Göttingen, in dem der Autist Marco lebt, könnte auf den ersten Blick auch eine ganz gewöhnliche kleine Wohnanlage sein: Dicht an dicht schmiegen sich fünf rote, flache Backstein-Bungalows aneinander. Hinter den grossen Fenstern leuchten bunte Vorhänge. Und in den grosszügigen Gärten, die zwischen den Häusern liegen, warten Gartenstühle und Hollywoodschaukeln aus massivem Holz, dass wieder Sommer wird. 140 erwachsene Männer und Frauen leben hier, Autisten, spastisch Gelähmte, Hirngeschädigte, Menschen, die blind, taub und stumm auf die Welt gekommen sind. Manche von ihnen können laufen und sprechen, manche starren abwesend nur vor sich hin, wieder andere geben ununterbrochen kleine Schreie von sich oder müssen sich ständig bewegen. Gitterbetten sucht man in dem Wohnheim dennoch vergeblich. Denn diese Betten sind meistens nicht die Lösung, sondern die Ursache des Problems, erklärt der Sozialpädagoge und Qualitätsbeauftragte des Heims, Martin Lüdke.
„Einen geistig Behinderten Menschen in ein solches Bett zu sperren, damit er sich oder andere nicht verletzt, ist insofern absurd, als die Agressivität oder der Drang zur Selbstverletzung meistens eine Folge der Langeweile ist, die gerade das Eingesperrt-Sein erst produziert. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich ein Bein gebrochen und müssen sechs Wochen beschäftigungslos im Bett herumliegen, sie dürfen nicht raus, sie dürfen nicht aufstehen – da wird doch jeder Mensch wahnsinnig.“ Für geistig Behinderte, denen meist ja nicht einmal Ablenkungen wie lesen oder Kreuzworträtsel zur Verfügung stehen, gelte das erst recht. „Wenn ein behinderter Mensch dauernd mit dem Kopf an die Wand schlägt oder sich die Haut aufkratzt, dann ist das ein Ausdruck grenzenloser Langeweile und der Versuch, sich mit dem Schmerz wenigstens irgendeine Form von Stimulation zu verschaffen“, sagt Martin Lüdke.„Als Betreuer muss man also versuchen, für die Behinderten ein Umfeld zu schaffen, in dem sie Beschäftigung und Anregung haben.“
Im Christophorushaus wird für jeden einzelnen Bewohner ein individueller Betreuungsplan, eine Art „Lebensstil“, erstellt, der nicht nur berücksichtigt, wie stark der Betroffene behindert ist oder wieviel Ruhe er braucht, sondern auch, welche Fähigkeiten, Vorlieben oder Interessen er hat. „Wir wollen den Alltag unserer Bewohner so abwechslungsreich wie möglich gestalten, damit sie in dem, was sie können, eine gewisse Variationsbreite erwerben“, sagt Martin Lüdke. „Die Leute sollen sich einfach wohlfühlen und glücklich sein.“ Bei vielen Bewohnern des Christophorushauses scheint das tatsächlich zu gelingen. Wie zum Beispiel bei Wolfgang.
Dass Wolfgang knapp 60 ist, verraten nur das graue Haar, die dicke Brille und die Tatsache, dass er gerne raucht. Denn geistig ist Wolfgang auf dem Niveau eines Kleinkindes stehengeblieben. Mit seinem dunklen Herrenanzug und einer Krawatte bekleidet fährt Wolfgang auf einem riesigen Dreirad durch die breiten, sonnendurchfluteten Gänge der so genannten Tagesförderstätte, in die nicht nur die Bewohner des Heimes, sondern jeden Tag für ein paar Stunden auch Menschen kommen, die in eigenen Wohnungen, bei ihren Familien oder in betreuten Wohngruppen wohnen (siehe Kasten). Auf dem Lenker sitzt ein Teddy. Und angesichts des unbekannten tschechischen Fotografen fragt Wolfgang irritiert, aber neugierig: „Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her?“
Wie alle Bewohner des Christophorushauses lebt auch Wolfgang in einer Wohngruppe mit sechs, sieben anderen Bewohnern. Es gibt Ein- oder Zweibettzimmer, wer will, darf seine Möbel selber mitbringen. Und wenn es unter den Behinderten Paare gibt, leben diese in zwei Zimmern, einem Wohn-und einem Schlafzimmer zusammen: „Wir achten auf Verhütung und darauf, dass keine sexuelle Ausbeutung stattfindet“, sagt Martin Lüdke. „Eine Bewohnerin war zum Beispiel bereit, nur für eine Tafel Schokolade mit jedem zu schlafen. Das geht natürlich nicht.“
Die Mitglieder einer Wohngruppe teilen sich eine Küche und ein Bad. Nach dem gemeinsamen Frühstück in der eigenen „Wohnung“ werden alle Bewohner hinüber in die Tagesförderstätte gebracht, wo sie in 15 Gruppen von je acht bis zehn Leuten bis zum Nachmittag „arbeiten“. Wolfgang ist in der so genannten „Flohmarktgruppe“, deren Mitglieder mit einem pädagogischen Mitarbeiter in einem Kleintransporter durch Göttingen fahren und bei Wohnungsauflösungen einsammeln, was noch zu gebrauchen und zu verkaufen ist.
„Manche unserer Bewohner sind so fit, dass sie eine echte Hilfe sind, zum Beispiel beim Kisten stapeln oder Papier zerreissen“, sagt die Sozialpädagogin Monica Wollner, die Leiterin der Tagesförderstätte. „Für die nicht ganz so schwer beeinträchtigten Frauen haben wir auch eine Gruppe die in unserer Wäscherei die Wäsche für alle Bewohner zusammenlegt. In einer dritten Gruppe sind Menschen, die ihre Behinderung erst im Laufe ihres Lebens etwa durch einen Unfall oder eine Krankheit erworben haben und vielleicht von ihrem früheren Beruf noch wissen, wie man mit einem Hobel umgeht, oder die sogar lesen oder schreiben können. Und wer immmerhin gehen, aber in diesen Gruppen dann doch nicht wirklich mithelfen kann, der puzzelt dabei eben einfach ein bisschen rum.“
Auch Wolfgang liebt seine Flohmarktgruppe nicht etwa wegen der Möbel. Er ist einfach begeistert, wenn er in den alten Sachen, die die Gruppe zusammenträgt, nach dem suchen kann, was er besonders liebt. Und das sind vor allem Herrenanzüge – und Spielzeugpistolen. Die Kombination aus Anzug und Pistole hat sich schon einmal als ziemlich effektvoll erwiesen, damals, als Wolfgang einem Besucher des Heims eine seiner Pistole vorführen wollte und dieser in der Überzeugung, es handele sich um eine echte Schusswaffe, die Polizei rief. „In seinem Anzug sieht Wolfgang auf den ersten Blick eben eher aus wie unser Geschäftsführer und nicht wie einer unserer Bewohner“, lacht Monica Wollner. Doch damit Wolfgang im Christophorushaus eher die Ausnahme.
Mustafa zum Beispiel ist nicht nur blind. Er hat viele Stunden am Tag auch ziemlich starke Schmerzen. Obwohl der kleine türkische Junge schon elf ist, hat er die Körpergrösse eines fünfjährigen. Wegen einer angeborenen Tetraspastik sind Mustafas Muskeln ständig so verkrampft, dass manchmal sogar seine Atmung aussetzt. Mehrmals die Woche besucht Mustafa deshalb die Physiotheapeutin Anja, die in der Tagesförderstätte einen eigenen Raum eingerichtet hat. In der Ecke stapeln sich Matten und Bälle. Mitten im Zimmer steht ein grosser Spiegel. Davor liegt eine grossse Gummirolle. Vorsichtig hebt Anja Mustafa aus dem Rollstuhl und setzt sich mit ihm rittlings auf die Rolle vor den Spiegel: „So sehe ich sein Gesicht und kann erkennen, ob die Übungen ihm guttun“, erklärt Anja und beginnt, Mustafas Arme und Beine sanft zu bewegen. Nach wenigen Minuten lässt die Spannung ins Mustafas Muskeln nach. Und schliesslich ist der kleine Junge eingeschlafen.
„Schwerstbehinderte wie Mustafa sind bei uns tagsüber in Gruppen, die kein spezielles Thema haben, sondern bei denen es vor allem um Entspannung und Stimulation geht“, sagt Monica Wollner: „Ein geistig behinderter Mensch spürt oft seinen Körper gar nicht, er hat als Kind keinerlei Gefühl dafür entwickeln können, wo die äusseren Grenzen seines Körpers sind. Und durch die Berührung mit unterschiedlichen Materialien, Formen, Temperaturen kann man dieses Körpergefühl fördern. Diese so genannte basale Stimulation ist gut für wirklich jeden - und sei er noch so beeinträchtigt.“ Auf dem Trampolin zu liegen und sanft zu wippen, in der Hängematte schwerelos durch den Raum zu schaukeln, den eigenen Körper im Wasserbad zu vergessen, den Sand in der Sandkiste fein rieseln zu lassen oder zu einem feuchten Matsch zu verarbeiten – es gibt viele Möglichkeiten, die Welt mit den Händen zu begreifen, die eigenen Sinne zu spüren und zu trainieren. Auf den Wasserbetten zum Beispiel, die in fast allen Gruppenräumen stehen, hat jede noch so kleine Bewegung einen hörbar glucksenden Effekt. „Manchmal reichen aber auch ganz einfach Dinge“, sagt Martin Lüdke und weist auf Mario, der neben Trisomie 21 auch eine schwere Hirnschädigung hat und deshalb alle paar Sekunden einen kleinen Schrei ausstösst – und der im Moment trotzdem jede Menge Spass hat, weil er in einer Art aufblasbarem Schwimmbecken mit vielen bunten Plastikbällchen sitzt, die er sich immer und immer wieder über den Kopf rollen lässt. „Natürlich lernen die Leute durch diese Stimulation hier nicht lesen und schreiben“, sagt Monica Wollner. „Aber man kann die Menschen dazu bringen, Bewegungen so oft zu wiederholen, bis sich im Gehirn vielleicht neue Nervenverbindungen bilden“, ergänzt Martin Lüdke. „Manche Leute lernen so zum Beispiel, selber mit dem Löffel zu essen, vorausgesetzt, man nimmt ihnen das Essen nicht durchs Füttern ab.“
Das Ende der zerquetschten Glübirnen
Unterstützen, ohne zu bevormunden – dieser Grundsatz zieht sich wie ein roter Faden durch den Alltag des Christophorushauses. Nachmittags machen alle Bewohner das, was ihnen Spass macht: Wer kann, geht mit den Mitarbeitern des Heims in die Stadt, andere trinken miteinander Kaffe, einmal die Woche kommt ein Arzt vorbei. Die Nacht beginnt erst um 22 Uhr. „Das sind doch erwachsene Menschen“, sagt Martin Lüdke. „Und Erwachsene gehen einfach nicht schon um acht ins Bett.“
Selbst für die rund 10 Bewohner, die wie Marco, der Autist, von Zeit zu Zeit ausser sich geraten, haben Lüdke und seine Kollegen inzwischen Lösungen gefunden, die möglichst wenig in die Freiheit und die Würde der Betroffenen eingreifen: Bei der Gruppeneinteilung zum Beispiel werden Autisten nicht mit Menschen zusammengesteckt, die viel Krach machen und bei den Autisten daher schnell Angst und Überforderung und aggressive Reaktionen auslösen. Gleichzeitig steht für jeden Autisten ein so genannter „time-out“-Raum zur Verfügung, in den er oder sie gehen kann, wenn es wieder mal zu viel wird. In Marcos Zimmer zum Beispiel sorgen dicke graue Gummimatten an den Wänden und eine Heizung oben unter der Zimmerdecke dafür, dass sich Marco nicht selber verletzen kann. Marcos ständiger Drang, sich die Windel aus der Hose zu pulen, ist kein Problem mehr, seit seine Betreuer ihm jeden Morgen einen blauen Mechaniker-Overall anziehen. Und weil Zelko, ein anderer autistischer Bewohner, den unwiderstehlichen Zwang hatte, Glühbirnen mit der Hand zu zerdrücken, Bilder von der Wand zu reissen oder auch den Boden seines time-out-Raums mit Kot und Urin zu beschmutzen, sind nun eben alle Glühbrinen mit kleinen Metallkäfigen umgeben, die Bilder hängen etwas höher und das Zimmer wurde mit einem leicht zu reinigenden Spezialfussboden ausgestattet.
„Wenn die Autisten spüren, dass ein Anfall naht, geben sie uns inzwischen ganz von selber zu verstehen, dass sie in den time-out-Raum wollen“, sagt Monica Wollner. „Nach 30 minuten ist es dann meistens wieder gut.“ Das alles bedeutet nicht, dass es nicht doch ab und an zu Verletzungen kommt. Doch die „schwierigeren“ Bewohner des Heims deshalb zu fixieren, das würde Martin Lüdke nicht einfallen. „Wenn Sie in Deutschland jemanden festbinden oder auch nur in einem Raum einsperren wollen, brauchen Sie dafür in jedem Einzelfall die Genehmigung eines Richters“, sagt er. „Ausserdem sind in den letzten Jahren hier in der Nähe mehrere Bewohner von Altenwohnheimen durch die Bauchfixiergurte zu Tode gekommen“, erzählt er. „Natürlich gab es damals Klagen von Angehörigen – und die Rechtsmedizin hat dann auch nochmals eindrücklich darauf hingewiesen, wie riskant diese Fixiergurte sind“.
Warum wir vieles wissen, aber doch nichts tun
Dass sich das Wohnheim an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse seiner Bewohner anpassen muss und nicht etwa umgekehrt; dass Behinderte nicht immer eine Rundum-Pflege, sondern lediglich eine Unterstützung und eine Förderung ihrer Fähigkeiten brauchen; dass ihr Tagesablauf so weit wie möglich dem Alltag eines nicht-behinderten Menschens entsprechen soll; und dass schliesslich Verhaltensauffälligkeiten nicht durch Restriktionen bestraft werden dürfen, sondern eventuellen Agressionen und Anfällen durch das Personal vorgebeugt werden muss – auch in Deutschland hat es viele Jahrzehnte gedauert, bis diese Grundsätze in den Behindertenwohnheimen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Nachdem die Nationalsozialisten im Zuge der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ schätzungsweise 300 000 behinderte Menschen ermordet hatten, spielten Menschen, die nicht durch den Krieg beschädigt worden waren, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. In den 1950er Jahren waren es vor allem die Eltern behinderter Kinder, die versuchten, ihren Kindern in Tageseinrichtungen eine Erziehung und Förderung ausserhalb der Familie zu ermöglichen. In den 1960er Jahren begann zwar auch der Staat, die Behinderten rechtlich und finanziell zu unterstützen. Doch dass Behinderte in der heutigen Bundesrepublik eine relativ starke politische Lobby in Form eines eigenen Beauftragten der Bundesregierung haben und dass Politik, Heime und (zumindest zum Teil) auch die Gesellschaft Behinderte nicht mehr - wie noch bis weit in die 70er Jahre hinein - als „Pflegefälle“ betrachten, sondern als gleichberechtigte Menschen, ist vor allem auf die politische Mobilisierung der Behinderten selbst zurückzuführen, die infolge der Studentenbewegung von 1968 entstanden ist. 1981 besetzten Behinderte die Bühne einer grossen Halle in Dortmund, auf der der damaligen Bundespräsident Carstens eine Rede zur Eröffnung des UNO-Jahrs der Behinderten halten wollte. Im selben Jahr attackierte einer der Behinderten-Aktivisten Carstens bei der Eröffnung der Reha-Messe mit einer seiner Krücken – denn Carstens sprach zum Thema „Behinderte“ immer nur von „Mitleid“ und „Nächstenliebe“. Von Selbstbestimmung, Integration und einem normalen Leben für die Behinderten war in Deutschland hingegen erstmals 1982 bei einem Kongress die Rede, bei dem moderne Konzepte für die Unterstützung behinderter Menschen aus dem europäischen Ausland und den USA vorgestellt wurden. Und so ist es keineswegs verwunderlich, dass auch die tschechische Politik einige Zeit gebraucht hat, bis sie begonnen hat, genau diese Grundsätze umzusetzen.
2007 trat das „Gesetz über soziale Dienstleistungen“ in Kraft, das vorsieht, dass jeder Bewohner eines Behindertenheims in einem individuellen Vertrag mit der Einrichtung festlegt, welche Form von Unterstützung er sich konkret wünscht. Das „Konzept zur Transformation stationärer Sozialdienstleistungen“, die die tschechische Regierung im Mai 2007 verabschiedet hat, geht für die Wohnheime von kleinen Wohneinheiten aus, in denen wenige Menschen in einer Umgebung leben, die nicht an ein Krankenhaus erinnert. Schon 2002 hat das Ministerium für Arbeit und Soziales so genannte „Qualitätsstandards“ verabschiedet, die den Heimen auferlegen, den Willen ihrer Bewohner zu achten und „problematischen“ Situationen durch das personal zuvorzukommen. Ein hierzu herausgegebenes „Vademecum“ soll den Anbietern sozialer Dienstleistungen die kritische Selbstreflektion und die Umsetzung der Standards erleichtern. Die neuen Gesetze und Vorschriften bewirken, dass sich kein einziges tschechisches Wohnheim einer Modernisierung seiner Arbeitsweise wird entziehen können. Doch genau wie in Deutschland vollzieht sich dieser Wandel sehr allmählich. Und einen genauen Überblick darüber, wie weit die einzelnen Heime auf diesem Weg bereits vorangekommen sind, hat derzeit niemand. Mithilfe von Inspektionen will das MPSV deshalb in diesem Jahr damit beginnen, die derzeit entscheidende Frage zu klären. Die Frage nämlich, was die Heime bislang eigentlich daran hindert, sich rasch in modernere, humanere Einrichtungen zu verwandeln.
Gesunde Langeweile
„Ich weiss schon, dass der moderne Trend zur Individualisierung geht. Aber wir machen unsere Ausflüge trotzdem im Kollektiv.“Jarmila Koubková hat sich in den letzten Jahren viele Gedanken darüber gemacht, wie und wohin sie „ihr“ Behindertenwohnheim führen soll. Seit 30 Jahren arbeitet die Mittfünfzigerin in dem Heim in Olšany, einem 1000-Einwohner-Dorf bei Šumperk. Ein Supermarkt, eine Kapelle, eine Papierfabrik und rundherum die idyllische Hügellandschaft der Ostsudeten – wie so viele Behindertenheime hatte wohl auch das Heim in Olšany seine Gründung in den 50er Jahren nicht zuletzt der Abgeschiedenheit des Ortes zu verdanken. 68 Jungen und Männer im Alter von 13 bis 51 Jahre leben hier – und sie hätten es schlechter treffen können. Das Haus ist vor kurzem in hellen freundlichen Farben renoviert worden. Hinter dem Haus erstreckt sich ein grosser Garten, in dem nicht nur zwei Gemüsebeete, sondern auch eine an Wildwest-Filme erinnernde grosse Lagerfeuerstelle, ein kleines Schwimmbecken und eine Hütte für die beiden Heim-Hunde Platz haben. Im Haus selbst gibt es eine kleine Turnhalle mit Basketballkörben und Tischfussball, und im Werkraum unterm Dach warten eine Töpferscheibe, ein Brennofen und jede Menge Lehm, Papier, Scheren und Pinsel auf kreative Geister. Bis auf drei Restexemplare wurden sämtliche Gitterbetten durch normale Holzbetten mit einem wenige Zentimeter hohe Rand ersetzt. Und trotzdem entspricht das Heim in Olšany in vielen Punkten noch nicht ganz dem, was man als modernen Stand bezeichnen würde.
Zwar wurden die zu kommunistischer Zeit üblichen grossen Schlafsäle inzwischen durch Wände in kleinere Zimmer aufgeteilt, die die Bewohner nach ihrem individuellen Geschmack einrichten und dekorieren dürfen. Doch die meisten Zimmer werden immer noch von drei bis sechs Männern bewohnt. Alle Bewohner essen zur gleichen Zeit in einem grossen Speisesaal - und zwar alle das gleiche Essen. Eine Angestellte muss sich im Durchschnitt um acht Bewohner kümmern, beinahe doppelt so viele wie die Kollegen in Göttingen. Und von den Frauen, die direkt mit den Bewohnern arbeiten, haben 37 Prozent keine pädagogische, sondern eine Ausbildung als Krankenschwester (in Göttingen sind es nur 7 Prozent).
Welche Folgen diese starke Präsenz medizinischen Personals hat, ist besonders im zweiten Stock des Gebäudes zu sehen, wo die vierzehn am schwersten behinderten Bewohner des Heims in zwei Schlaf- und einem Spielzimmer leben. Marek, Martin, Honza und wie sie alle heissen, sind satt, sauber und gesund. Doch um ihnen ein wirklich anregendes Umfeld zu bieten – dazu fehlt den beiden Krankenschwestern Eliška und Anna sowohl die Ausstattung als auch die Ausbildung. Zwar liegt in dem Tageszimmer überall Kinderspielzeug herum. Doch wirklich beschäftigt ist lediglich der 23jährige Kuba, der mit dem Mund malen und Buchstaben legen kann. Die beiden 13jährigen Zwillinge Honza und Martin hingegen stehen an einer Holzstange und bewegen sich unablässig monoton hin und her. Der 18jährige Lukáš liegt im Bett. Mehrere andere sitzen beschäftigungslos im Rollstuhl. „Diese Bewohner hier müssen wir vor allem wickeln, füttern und waschen“, sagt Eliška, eine der beiden Krankenschwestern. „Aber wenn das Wetter gut ist, fahren wir sie auch nach draussen.“ Von sinnlicher Stimulation oder gar einer gezielten Förderung von Kompetenzen kann hier jedoch keine Rede sein. Obwohl ausser Honza und Martin alle erwachsen sind, gehen alle schwerbehinderten Bewohner des Heims schon kurz nach 19 Uhr in ins Bett.
Dass in ihrem Heim noch nicht alles optimal läuft – dessen ist sich Jarmila Koubková, die Direktorin, durchaus bewusst. „Ich bräuchte mehr Sozialarbeiter“, sagt sie. „Und eigentlich müssten auch gar nicht alle unsere Bewohner wirklich in einem Heim wohnen. Es wäre schön, wenn wir hier einzelne Wohnungen mit einer Betreuung hätten“, sagt sie. Wie intensiv sie sich um derartige Wohnungen bemüht hat, wird allerdings nicht ganz klar. Zwar sei schon einmal darüber nachgedacht worden, ein Haus im Ort in Wohnungen für Behinderte umzuwandeln. Doch schliesslich ist das Projekt gescheitert, am Geld, aber vielleicht aber auch daran, dass Jarmila Koubková sich selbst, dem Heim und ihren Bewohnern nicht zu viel Neues auf einmal zumuten wollte: „Es ist besser, Veränderungen allmählich zu machen“, sagt sie mit Blick auf die Umbauarbeiten an ihrem Haus. „Und vieles können meine Jungs hier ja auch selber machen.“ Auch der Idee, das Wohnheim für Frauen zu öffnen, und damit eine natürlichere Umgebung für „ihre Jungs“ zu schaffen, steht Jarmila Koubková skeptisch gegenüber: „Wenn wir uns, was ein paarmal im Jahr vorkommt, mit den Bewohnerinnen aus Frauenheimen treffen, dann sind unsere Bewohner am Anfang immer ganz begeistert – aber schon nach einer Woche wollen sie, dass die Frauen wie der abreisen. Dann gehen sie ihnen auf die Nerven.“
Das Wunder auf dem Gutshof
Zu wenig und falsch ausgebildetes Personal, kein Geld, kein Platz, keine Hilfe von aussen - die Antwort auf die Frage, warum sich die tschechischen Behindertenheime nicht rascher in moderne Einrichtungen verwandeln, lautet fast immer gleich. In vielen Heimen scheint die fehlende Orientierung an den individuellen Wünschen der Behinderten deshalb eine unausweichliche Folge der finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu sein. Doch ganz so hoffnungslos ist die Lage nicht. Denn die grundlegende Modernisierung der Heime ist nicht nur eine Frage der Finanzierung durch den jeweiligen Träger (meist der Bezirk oder die Gemeinde). Eine entscheidende Rolle kommt dabei auch der Heimleitung und den Eltern der Behinderten zu.
„Was man vor allem braucht, ist der Mut, nicht immer nur blind zu gehorchen, sondern auch mal seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten.“Hana Charvátová ist stellvertretende Direktorin im „Diagnostik-Institut für Sozialfürsorge“ in Tloskov, etwa 60 Kilometer südlich von Prag. Das alte Adeligen-Gut, in dem heute 239 geistig behinderte Menschen wohnen, war vor der Revolution ein Paradebeispiel für die völlig veraltete Behindertenarbeit in den kommunstischen Staaten: Riesige Schlafsäle, in denen viel zu viele Bewohner zusammengepfercht waren, eine Atmosphäre wie im Krankenhaus, stumpfsinnige Beschäftigungen etwa als billige Arbeitskraft bei der Kartoffelernte. Heute stellt Tloskov, das einzige staatliche Heim für geistig Behinderte, die vielleicht modernste Einrichtung ihrer Art in Tschechien dar: In den bunt gestrichenen Häusern leben Männer und Frauen in ein- oder Zweibettzimmern in kleinen Wohngruppen von vier bis fünf Menschen zusammen. Paare können zusammen ein grosses Zimmer beziehen – und wer besonders fit ist, kann auch eine kleine Wohnung im Dachgeschoss wählen, in der nur ab und zu einer der insgesamt 154 sozialen und pädagogischen Betreuer vorbeisieht. Jeder einzelne Bewohner bekommt einen sogenannten „Schlüsselbetreuer“ zugewiesen, der sich für „seinen“ Behinderten um sämtliche Fragen der Therapie und der Tagesaktivitäten kümmert. Denn an beidem ist die Auswahl gross: Wer nicht ausserhalb des Heimes in einem Betrieb in der Umgebung arbeitet, kann tagsüber in einer komplett eingerichteten Schlosser-, Holz- oder Keramikwerkstatt Nützliches und Schönes herstellen, oder basteln, malen und Kerzenziehen. Auf dem Gelände gibt es ein Cafe und eine kleine Tierfarm. Und von der Wasser- oder der Musiktherapie profitieren auch die am allerschwersten behinderten Bewohner.
Einzigartig ist das Heim in Tloskov aber nicht nur wegen der Vielfalt an Möglichkeiten, zwischen denen die Bewohner wählen können.Etwas ganz besondere ist das Heim auch deshalb, weil es neben dem Wohnheim auch eine ganze Reihe anderer Dienstleistungen für behinderte Menschen und ihre Familien bietet: So gibt es nicht nur ein Tageszentrum, oder den so genannten Entlastungdienst, der einspringt, wenn die Eltern behinderter Menschen einfach mal Urlaub brauchen oder ins Krankenhaus müssen. An drei Wochenenden im Monat können sich Eltern bei so genannten „Rooming“-Tagen auch Anregungen dafür geben lassen, welche Aktivitäten ihren Kindern Spass machen und sie zugleich fördern. Wer sein behindertes Kind in der Familie zuhause betreuen möchte, findet in Tloskov also jede Menge Unterstützung. Und wenn man Hana Charvátová fragt, wie der Wandel von der kommunistischen Anstalt zum moderen Dienstleistungskomplex vonstatten gegangen ist, bekommt man eine überraschend radikale Antwort.
Auch Ihr Kind hat ein Recht auf Sex
„Wir haben ziemlich rasch nach der Wende festgestellt, dass uns die vielen Krankenschwestern, die damals hier gearbeitet haben, eher daran hindern, auf die Bedurfnisse unserer Klienten einzugehen. Diese Mitarbeiter haben dauernd immer nur darauf geachtet, ob auch ja alle Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. Und deshalb haben wir den Krankenschwestern gesagt: Entweder, ihr seid bereit, für weniger Geld die Arbeit eines Sozialarbeiters zu machen, oder ihr werdet in sechs Monaten entlassen.“ Nur zwei Mitarbeiterinnen haben sich entschlossen zu gehen – die anderen wurden während des halben Jahres auf die Art von Arbeit vorbereitet, die die Heimleitung von ihnen erwartete. „Wir sind gleich nach der Wende viel in die Niederlande, nach Dänemark und nach Deutschland gereist und haben uns Einrichtungen dort angesehen“, erzählt Antonín Dušek, der Direktor des Heimes. „Und daraufhin haben wir unserem Personal beigebracht, dass es vor allem darum geht, die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu befriedigen und ihre Selbständigkeit zu fördern.“ Leicht gefallen ist diese Umstellung nicht. Und noch immer gibt es Mitarbeiter, die den Bewohnern getreu alten Grundsatz „je mehr Pflege, desto besser“ jeden Handgriff abnehmen wollen. „Bis das neue Denken im Umgang mit den Bewohnern selbstverständlich ist, wird wohl eine Generation vergehen“, sagt Hana Charvátová.
Den Heimbewohnern wie erwachsenen, gleichwertigen Menschen zu begenen, wird den Mitarbeitern der tschechischen Behindertenwohnheime allerdings nicht nur durch die alten Gewohnheiten, sondern auch durch die Gesellschaft schwergemacht. „Einige Leute hier im Ort meinen, wir sollten unsere Jungs nicht alleine in den Wald gehen lassen, damit sie die anderen Spaziergänger dort nicht verletzen“, erzählt Jarmila Koubková aus Olšany. „Und wenn ich mit den Behinderten hier in den Supermarket gehe, sagen manche Leute: Wer soll sich das denn angucken?“ In Deutschland wurde diese Frage zuletzt 1980 öffentlich gestellt – und zwar von einer Touristin, die ihren Reiseveranstalter vor Gericht auf Schadenseratz verklagte, weil sie im Urlaub hatte behinderte Menschen sehen müssen. Das Gericht gab ihr Recht – und löste damit eine Demonstration aus, zu der 5000 Menschen auf der Strasse protestierten. Heute würde in Deutschland niemand mehr wagen, den Anblick von Behinderten als Zumutung zu bezeichnen. Doch dass Tschechien davon noch weit entfernt ist, wissen auch die Angestellten des Heims in Tloskov zu berichten.
„Es kommt vor, dass Richter einen behinderten Menschen im Gerichtsverfahren einfach duzen“, sagt Hana Charvátová, „Oder dass sie den Betroffenen erst gar nicht zu seinem eigenen Verfahren einladen.“ Manchmal müssen die Angestellten die Behinderten sogar gegen ihre eigenen Eltern in Schutz nehmen. „Eine Mutter wollte zum Beispiel nicht, dass ihre behinderte Tochter hier im Heim mit ihrem Freund zusammenlebt“, erzählt Hana Charvátová. „Der musste ich dann erklären, dass ihre Tochter genauso ein recht auf Sex hat wie wir alle. Ein Vater wiederum hatte etwas dagegen, dass sein Sohn hier alleine ins Dorf gehen darf. Auch dem mussten wir klarmachen, dass er kein Recht dazu hat, dem Sohn das zu verbieten.“
Die Angst der Eltern ist es auch, die erheblich dazu beiträgt, das viele Heime noch immer an den umstrittenen Gitterbetten festhalten. „Als Heimleiter lebe ich ständig unter dem Damoklesschwert, dass die Eltern sie sofort verklagen, wenn dem Kind irgendetwas passiert“, sagt Hana Charvátová. Die meisten Heime wollen deshalb tatsächlich nicht das geringste Risiko eingehen, dass der Bewohner aus dem Bett fallen könnte. Auch das Heim in Tloskov hat deshalb für manche seiner schwerstbehinderten Bewohner Betten mit hohen, aber verstellbaren Seitenwänden. „Aber dank des neuen Gesetzes über soziale Dienste schliessen wir jetzt ja mit jedem Bewohner einen individuellen Vertrag ab, in dem genau festgelegt wird, zu welchen Bedingungen er hier wohnt“, sagt Hana Charvátová. „Und wenn die Eltern auf keinen Fall wollen, dass ihr Kind in einem solchen Bett liegt, dann wird dieser Behinderte auch nie in einem solchen Bett liegen.“
Warum Geld doch wichtig ist
Heimleiter, die sich ihr Personal selbst zurechtschulen, öffentliche Institutionen, die Behinderte wie vollwertige Mitglieder der Gesellschaft behandeln, und Eltern, die ihre Kinder nicht durch eine völlig übertriebene Sorge um elementare Rechte bringen – das Leben der Behinderten in Tschechien normaler, selbständiger und lebenswerter zu gestalten, ist ein Ziel, zu dem jeder einzelne Tscheche, jede Firma, jeder Beamte beitragen muss. Und in diesem Zusammenhang spielt schliesslich auch jener Faktor eine wesentliche Rolle, der in der Diskussion um die Modernisierung der tschechischen Heime gerne als ester genannt wird: das Geld. Wer will, dass sich die Lage in den Behindertenheimen bessert, der wird das skandalös niedrige Gehalt der Sozialarbeiter anheben müssen. Denn die Frage, wieviel Gehalt ein bestimmter Beruf im Monat einbringt, entscheidet erheblich über dessen gesellschaftliches Prestige und Attraktivität. Für maximal 15 000 Kronen brutto im Monat ist es für die Heime nicht nur schwer, überhaupt Personal für die physisch wie psychisch sehr anstrengende Arbeit zu finden. Geradezu ausgeschlossen ist es, mit diesem Gehalt männliche Mitarbeiter (meiste die Hauptverdiener in tschechischen Familien) zu gewinnen, die besonders für männliche Behinderte nicht nur wichtige Bezugspersonen, sondern im Fall von agressiven Ausfällen auch über die nötige körperliche Autorität verfügen. „In Deutschland verdient ein pädgogisch ausgebildeter Betreuer ohne Hochschulstudium auch nur etwa 2500 Euro brutto im Monat“, sagt Martin Lüdke vom Christophorushaus in Göttingen. „Das ist rund 30 prozent weniger als das Durchschnittsgehalt in der Industrie.“ Da die Behindertenarbeit in Deutschland mittlerweile aber als „gute Sache“ gilt und die Arbeitsplätze in den heimen zudem „sicher“ sind, ist der Beruf auch für Männer so attraktiv, dass in Göttingen rund 30 Prozent der Mitarbeiter männlich sind.
Ein zweiter Punkt, in dem eine politische Entscheidung für eine bessere Finanzierung der Heime gefagt ist, betrifft die oft völlig ungeeigneten Gebäude, in denen die Heime untergebracht sind: Einzelzimmer, Therapieräume, Wohngruppen, Arbeitsgebäude – für diese Umbauten benötigen die Heime zusätzliches Geld. Und ohne die Investitionen des MPSV gäbe es all dies auch in Tloskov nicht. „Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Menschen mit Behinderungen steigen ständig“, sagt Martin Žarský vom MPSV. „Aber die Bereitschaft, in soziale Dienste zu investieren, wächst bei vielen Politikern tatsächlich erst in dem Moment, in dem sie selber einen solchen Dienst benötigen - etwa weil ihre alte Mutter plötzlich krank wird.“ Auf solche Zufälle dürfen die tschechischen Behinderten nicht länger warten müssen. Und um so wichtiger sind deshalb die so genannten „kommunalen Pläne“, in denen immer mehr tschechische Gemeinden versuchen, das Angebot an sozialen Dienstleistungen am tatsächlichen Bedarf vor Ort auszurichten. „Wenn es gelingt, eine ernsthafte Diskussion zwischen denen anzustossen, die Hilfe brauchen, denen, die über diese Hilfe entscheiden können, und denen, die diese Hilfe anbieten“, sagt Martin Žarský vom MPSV, „dann kommt es überraschend schnell nicht nur zu einer Änderung der politischen Prioritäten - sondern auch zu konkreten, positiven Taten.“
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].